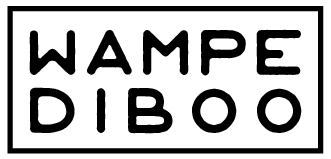Achtsamkeitstraining – und wie ich da hineingestolpert bin
Die Tür geht auf. Mich erwartet Stille. Lediglich das Klappern des Bestecks und der ein oder andere Schmatzer sind zu hören. Mein Training der Achtsamkeit hätte ich nicht unpassender beginnen können. Ich, die zu spät kommt. Und das lautstark. Ich fasse mir innerlich an die Stirn.
Und obwohl ich zuvor angekündigt hatte, dass es bei mir etwas später wird, da ich an diesem Samstagabend noch Yoga unterrichtet habe, fühle ich mich unwohl. Vermutlich liegt das an meiner schier unendlichen Energie, mit der ich die Wohnung betreten habe – bereit neues Wissen über Achtsamkeit und Zen aufzusaugen wie ein Schwamm. Ich muss lächeln. Denn diese Energie prallt ab an einer Wand aus Stille, Entschleunigung und dem Duft von Blaukraut, Knödel und Pilzsoße. Schmatz, Schmatz. Denen, die schon sitzen schmeckt’s wohl. Ich atme aus. Ufff. Genau das ist es, was ich in genau diesem Moment gebraucht habe – nicht die Knödel, sondern diese Stille, die mir zeigt, worauf es wirklich ankommt. Weniger sprechen oder gelehrt bekommen, mehr fühlen und beobachten, ohne gleich einzuordnen.
Einfach essen
Also beginnt an diesem Abend mein Coaching mit Stille, die ich so so nötig habe. Ich übe mich gleich in zwei auch im Yoga sehr wichtigen Lektionen: Nicht bewerten, lieber selbst begutachten – und essen. Einfach nur essen. Und das ist Meditation. Essen. Jeden Bissen wahrnehmen und nicht achtlos schlingen, dabei plaudern oder Podcast hören.
Wir sind an diesem Abend zusammen, um uns kennenzulernen. Aber erst einmal ist da Stille. Mit mir sitzen zwölf andere auf Tatami-Matten um den Tisch. Ich fühle mich wie ein tollpatschiges kleines Mädchen, das auf dem heimlichen Weg zum Süßigkeitenregal den Dielenboden zu laut knarzen lässt, dass es schon jetzt keine Aussicht mehr auf Erfolg gibt.
Mit einem Unterschied. Niemand gibt mir das Gefühl, unpassend zu sein. Lediglich mein Affenhirn und ich verstricken uns in einem sinnlosen Dialog. Ich setze mich. Schließe die Augen und atme kurz durch. Mir wird schlagartig bewusst, wie schön das ist. Stille. Und Essen. Tiger und ich haben das bereits ein paar Mal probiert: achtsames Essen. Und jedes Mal waren wir uns einig: Eigentlich ist das ’ne ziemlich gute Sache! Aber wie das so oft mit guten Sachen ist, man macht sie viel zu selten.
Im Hamsterrad der Bürokratie
Neun Monate nur rumsitzen und essen? Nicht ganz. Mich erwarten die nächsten Wochen viele Workshops zu Themen wie Wut, Glück, bewusstes Gehen, bewusste Kommunikation, Bewusstsein, Liebe oder Stille. Die Workshops zu den Themen Loslassen und Bewegung fanden bereits statt. Es ist gar nicht so einfach zu beschreiben, was ich dabei lerne. Und vielleicht muss ich es auch nicht beschreiben, denn irgendwas tut sich in mir, das ich gar nicht so recht in Worte fassen kann. Ich versuche es mal so: Am Ende dieser Ausbildung steht kein Zertifikat, sondern Erkenntnisgewinn. Ausgebildet werden um des Ausbildungswillen – hätte nicht gedacht, dass sowas im Land der Studienbriefe, Ausbildungsbescheinigungen und zertifizierten Prüforganisationen möglich ist. Geschweige denn, dass ich mich drauf einlasse. Am Ende geht es nicht darum zu sagen: Guggt mal, jetzt kann ich euch in Achtsamkeit unterrichten, denn ich habe diesen Schein! Das ist ein ziemlich deutsch-bürokratisches Verhalten. Ausbildung machen, Schein bekommen, fähig sein, zu unterrichten. Jawollo. Nein, es geht viel mehr um eine persönliche Weiterentwicklung. Das, was ich während der Workshops bereits über mich selbst gelernt habe, übersteigt meine Vorstellung dessen, was ich erwartet habe. Ich gebe zu, auch ich dachte mir: Ja, gut. Da gebe ich Geld aus, für ein Zertifikat, das meinem Yogaunterricht am Ende gar nix bringt. Meeeeep! Und da ist er schon der verschwurbelte Bürokratiegedanke. Ich glaube, am Ende bringt diese Weiterbildung mehr als jede andere: Denn ich eigne mir nicht nur Wissen über Meditation und Achtsamkeit an, ich erlebe sie – dadurch bleibt am meisten hängen.
Achtsamkeit und Zynismus
Ich erkenne die Farce des Moments, in den ersten Abend des Achtsamkeitstrainings hereinzuplatzen, wie ein Elefant in den Porzellanladen. Aber es sind letztlich doch nur mein grenzenloser Zynismus und mein Ego, die mich überzeugen möchten, dass in diesem Auftritt eine gewisse Komik liegt. Und eine Metapher, die die Meister des Zens ja irgendwie auch immer schätzen… Durch bildhafte Geschichten zeigen sie ihrem Gegenüber, was es hören muss, ohne darüber zu sprechen. Da ist zum Beispiel dieses kleine Mädchen, das Thich Nhat Hanh – den wohl bekanntesten Zen-Meister unserer Zeit und Autor vieler Bücher über Achtsamkeit – einmal fragte: „Ich hatte ein Hündchen und das Hündchen ist gestorben und ich weiß nicht, wie ich nicht mehr so traurig sein kann.“ Er antwortet: Du blickst hinauf in den Himmel und siehst eine wunderschöne Wolke. Die Wolke ist Regen geworden. Und wenn du deinen Tee trinkst, dann siehst du die Wolke in deinem Tee.
(Da kann man jetzt denken: Hä?! Whuaaat?! Oder das Ganze einfach kurz wirken lassen und dahinter blicken. Das wäre dann wohl ein erster Schritt Richtung Achtsamkeit.)
Dieses Mädchen bin ich. Nur hatte ich nie einen Hund und der ist auch nicht tot. Aber die Metapher des Augenblicks macht mir klar, worum es bei dieser Achtsamkeit eigentlich geht: Wenn wir abspülen, ärgern wir uns übers Abspülen. Wenn wir im Stau stehen, ärgern wir uns über die anderen Autofahrer. Wenn wir uns also in einer unangenehmen Situation befinden, kreieren wir noch mehr Ärger, indem wir uns ärgern, anstatt uns über das saubere Geschirr, oder Zeit ganz für uns im Auto zu freuen. Den Stau können wir eh nicht ändern, warum also ärgern? Für mich bedeutet diese Achtsamkeitsweiterbildung: Weniger „Schublade auf, Vorurteile rein“, mehr „Einfach mal hinhören und hinfühlen“. Weniger Erwartungen, mehr Gegenwart. Weniger machen, und doch mehr machen.